| Medienphilosophie(n) Frank Hartmann |
Korr.
Fassung / Feb. 2002 - Printversion erscheint in: Stefan Weber (Hg.): Medien- und Kommunikationstheorien. Paradigmen, Theoriespektrum, Komparatistik. Konstanz: UVK 2002 (i.E.) |
1 - Zum Begriff "Medienphilosophie" 2 - Philosophische Spurensicherung 3 - Bilderverbot 4 - Medienwirklichkeiten 5 - Sprache, Kultur, symbolische Form 6 - Phänomenologischer Ansatz 7 - Nicht Sein, nicht Schein 8 - Geschichte und mediale Dispositive 9 - Medien als die neue Natur 10 - Schrift, Rhizom, Netz 11 - Kommunikologie 12 - Ausblick Literaturangaben |
|
|
|
Die Ausdifferenzierung der Medientechnik in den postmodernen Gesellschaften hat neue kulturwissenschaftliche Ansätze erzeugt, die sich jenseits der tradierten disziplinären Schemata platzierten, um diese im Detail wiederum (leider) zu reproduzieren: so gibt es neben einer Medienwissenschaft, Medientheorie, Mediensoziologie, Medienökonomie, Medienarchäologie, Medienästhetik, Medienpädagogik etc. neuerdings auch eine Medienphilosophie. Wie jede disziplinäre Spezifizierung wird sie ein Fachwissen erzeugen, welches bei bestimmten Problemlagen konsultiert werden kann - um sich mit derselben Wahrscheinlichkeit aber von der breiteren Debatte abzusondern oder nur weiteren abgehobenen Jargon zu generieren? Sicherlich ist, wie in jeder anderen Disziplin, der Grad der Verwendung einer enigmatischen Terminologie ein Maß für letzteres; ein weiterer Indikator ist die Einschränkung auf selbstgestellte Fragen und einzelne Fachautoritäten. Die Frage, ob es eine Medienphilosophie im strikten Sinn bereits gibt, soll hier eine offene bleiben: mit dem Hinweis darauf, dass sie sich in die Frage nach dem konkreten Fachwissen und den bestimmten Problemlagen, in denen die Medienphilosophie tätig wird, auflösen wird lassen. Im besonderen Fall der Medienphilosophie bricht sich der disziplinäre am generalistischen Anspruch, der sich mit der Bezeichnung "Philosophie" verbindet. Schließlich herrschte lange Zeit die Rede von einer Philosophie der Natur, bevor es Naturwissenschaften gab, oder die von einer Philosophie der Seele, bevor es die Psychologie gab. Hier aber handelt es sich weniger um eine Philosophie der Medien (d.h., je nach Anwendung des Genetivs: Was hatten/haben die Philosophen zu den Medien zu sagen? Haben gar die Medien eine eigene Philosophie?) als um eine Bündelung von Fragen, die nach wie vor mit der philosophischen Frage nach der Conditio humana, nach der Stellung des Menschen in der Welt zu tun haben, die im Gegensatz zum philosophischen Historismus (Was Aristoteles über die Medien gesagt hat...) auf die Gegenwart und die Zukunft gerichtet sind: auf das Begreifen dessen, was als kultureller Wandel vor sich geht, und ein Skizzieren dessen, was in einer künftigen anthropologischen Situation möglich sein könnte. Grundlage für jede medienphilosophische Reflexion ist jener "Umsturz der Codes" (Flusser 1996), der im Austritt aus der Gutenberg-Galaxis (McLuhan 1962) den kulturellen Kontext neu bestimmt.
|
||
|
1 - Zum Begriff "Medienphilosophie" Medienphilosophie beinhaltet neben der systematischen auch eine rekonstruktive, ausgesuchte Momente der philosophischen Tradition einer aneignenden Re-Lektüre unterwerfende Fragerichtung (Hartmann 2000). Im Sinne der Frage nach den Medien der Philosophie richtet sie sich wohl auch auf die materialen Bedingungen der Möglichkeit bestimmter theoretischer Diskurse, wobei die kulturbestimmende Literalität mit einer neuen Taktilität (McLuhan 1964) bzw. der rein geistige Sinn philosophischer Diskurse mit den Sinnen rückgekoppelt wird (Hörisch 2001). Werden die selbstgenügsamen Textwelten mit Bilderwelten, Sounds, Programmierungen etc. konfrontiert, dann sind in der Folge durch die Frage nach dem Ort und dem Träger geistiger Gebilde auch die Produktionsbedingungen von Philosophie zu hinterfragen (Koch/Krämer 1997). Emergente Netzstrukturen schließlich bilden jenen neuen Rahmenbedingungen, in denen der sinnlich-geistige Doppelbezug des Menschen zu sich und seiner Welt (Faßler 2001) am keineswegs immateriellen, aber physisch kaum mehr greifbaren Cyberspace neue Erwartungshaltungen produziert. Es wäre jedoch ein Irrtum anzunehmen, dass mit einer Bezeichnung allein auch schon eine neue Disziplin etabliert, geschweige denn der Anspruch auf eine neue Form von Fundamentaltheorie gewonnen wäre. Ebenso wenig genügt es umgekehrt, ein wenig fachphilosophische Terminologie zu Fragen des menschlichen Wirklichkeitsbezugs jetzt zur Abwechslung einmal auf Medienthemen anzuwenden. Der Begriff Medienphilosophie soll hier vorerst nur für übergeordnete wie übergreifende Fragen stehen, die mit der Veränderung kultureller Codes (und damit einer möglichen neuen Anthropologie) zu tun haben. Weiters bedeutet er für eine Fortführung des philosophischen Projekts der Moderne, welches die grundsätzliche Mediatisiertheit des menschlichen Daseins bereits in unterschiedlichsten Facetten thematisiert hat. So hielt die philosophische Erkenntnistheorie (Epistemologie) fest, dass die Welt dem Menschen nicht unmittelbar gegeben ist, sondern stets vermittelt über einen sinnlichen Wahrnehmungs- und einen vernünftigen Erkenntnisapparat, über zwischengeschaltete Symbolsysteme wie die Sprache bis hin zu kulturellen und technischen Programmierungen. Mit den neuen Speicher- und Übertragungsmedien des 19. und dem Übergang von analogen zu digitalen Medien des 20. Jahrhunderts haben diese Programmierungen eine definitive Eigendynamik in Richtung einer Abkopplung der Maschinenwirklichkeit von der Menschenwelt entwickelt. Hierbei ist bemerkenswert, dass der Linguistic turn der Gegenwartsphilosophie, der im 20. Jahrhundert gegenüber einer früheren Konzentration auf Bewusstseinsphänomene zunehmend die Sprachphänomene zum Thema gemacht hat (Rorty 1967), nunmehr seine Überbietung erlebt, da Medien als Materialitäten der Kommunikation nicht länger als neutrale Botschafter, sondern als durchaus sinnerzeugende Agenten betrachtet werden. Aus-gangspunkt für diese Betrachtungsweise waren Schriften über den Zusammenhang von Wahrheitsaussagen und Diskursordnungen (Foucault 1974) sowie der Abhängigkeit des europäischen Denkens von der linearen Schrift oder einem spezifischen Logozentrismus (Derrida 1974) im Sinne seiner "Schriftvergessenheit". In Rezeption dieser Ansätze setzte ein Exponent der deutschen Literaturwissenschaft auf eine neue Form der Diskursanalyse, die klassische Kate-gorien der Sinnproduktion distanzierte: das Prinzip der Informationsverarbeitung und damit die technischen Medien bedingen als Aufschreibesysteme die Struktur literarischer Werke (Kittler 1987); überdies steuern die technischen Medien jegliche Überlieferung und damit das, was gemeinhin eine Kultur ausmacht: als Schreibzeug, als Schaltung, als Hardware, die in Anlehnung an McLuhans Theorem The Medium is the message den eigentlichen Schematismus von Wahrnehmbarkeit bilden - und nicht Geist, Inhalte, oder gar Botschaften (Kittler 1986). In einer von Hermeneutik und bewusstseinsphilosophischen Versatzstücken geprägten akademischen Welt wirkte dies wie ein Befreiungsschlag, allerdings nicht ohne in neue Borniertheiten zu münden: Es gibt keine Software, sollte es bald zugespitzt heißen - jegliche Schreibakte verblassen vor der Faktizität medialer Schaltungen, die in die "Transistorzellen von Computern" verlagern, was einst mit sinnproduzierendem Anspruch in menschlich wahrnehmbaren Zeiten und Räumen existiert haben mag (Kittler 1993, 225). |
||
|
2 - Philosophische Spurensicherung Aufgrund der neu erwachten Aufmerksamkeit für die Materialitäten der Kommunikation oder die Medialitäten des Geistes lassen sich verschiedenste Versatzstücke der jüngeren Philosophiegeschichte neu interpretieren und neu ordnen. Dies kann bedeuten, dass die erkenntnistheoretischen Reflexionen durch sei es Sprachkritik, oder Zeichentheorie (Semiotik) grundsätzlich tangiert werden. Die Bestimmung, in welchem Ausmaß dies zutrifft, wäre einerseits ein Desideratum der medienphilosophischen Forschung. Andererseits gibt es genügend Anknüpfungspunkte und liegengebliebene Fragen der Tradition, die ein starkes Motiv für eine Medienphilosophie im Sinne einer rekonstruierenden Wiederaneignung vermuten lassen: die Grundlagen einer neuerdings Kulturwissenschaft mit Kulturtechnik verschränkenden Rekonstruktion (Kittler 2000) sind hier ebenso zu nennen wie einzelne Analysen, mit denen schon in den sechziger Jahren das Thema Kommunikation seiner technizistischen Verengung entrissen und mit philosophischem Anspruch ausgestattet worden ist (Serres 1991). Michel Serres jedenfalls untersucht auf einer mathematisch-strukturalen Interpretationsfolie klassische philosophische Probleme neu, wie etwa die Kommunikation zwischen den Substanzen bei Leibniz, oder das Problem der methodischen Vorbedingungen in der Erkenntnistheorie von Descartes - philosophische Spurensicherung an den Wegmarken zwischen Mathematik und Kommunikation, sowie den zugehörigen Zuständen, Ordnungen und Operationen (wie "Interferenz", "Übersetzung", "Verteilungen" und Interface - wie es die Titel von Hermes I-V andeuten, vgl. Serres 1991ff). Dass traditionelle philosophische Fragestellungen, welche um die Problematik einer Medialität des Kognitiven kreisen - gleich ob diese durch den Terminus Medium nun explizit gemacht worden ist oder nicht - immer neue Aktualisierungen erleben, zeigen die untergründigen Verbindungslinien, die sich von verschiedenen philosophischen Klassikern zu aktuellen Theorieansätzen ziehen lassen: von René Descartes zu Noam Chomsky, wenn es um die Tiefenstruktur universaler Ideen für den Ausdruck des Denkens geht, von Gottfried Wilhelm Leibniz zu Ludwig Wittgenstein, wenn es um die Sprache als Spiegel des Verstandes oder Grenze meine Welt geht, von Giambattista Vico zu Jacques Derrida, wenn es um die Kritik des Logozentrismus oder um die der Sprache vorgängige Struktur der Schrift und des Schreibens geht (vgl. v.a. die Beiträge von Hans Poser und Jürgen Trabant in Koch/Krämer 1997, 127ff bzw. 149ff). Medienphilosophie ist also immer auch eine philosophische Spurensicherung liegengebliebener Aufgaben. Sprache war in der Philosophie seit jeher kein unbekanntes Thema, aber deshalb ist nicht jede Philosophie, die Sprache thematisiert hat, schon eine Medienphilosophie im engeren Sinne. Die beginnt erst dort, wo Schrift und die Praxis des Schreibens im Diskurs präsent sind, und zwar in dem Sinne, dass kognitive Leistung und Kulturtechniken (auch nicht verbalsprachliche) zusammengedacht werden und der Mensch nicht auf ein sprachlich kommunizierendes Wesen allein beschränkt wird - dort also, wo Leibniz' Beobachtung, dass alles menschliche Denken durch Zeichen erbracht werde, im emphatischen Sinn ernst genommen und möglicherweise in Richtung einer multimedialen Erkenntnistheorie weiterentwickelt wird. |
||
|
3 - Antimedialismus Das Nachdenken über Medien als Bedingung für das Denken und die Kultur findet sich bei den auf Wahrheit verpflichteten Philosophen von Anfang an. Meist jedoch in Form eines strikten Antimedialismus, der die Medien als etwas wahrnimmt, das nur Oberfläche, Suggestion, Simulation produziert und somit den Blick aufs Wesentliche verstellt. So in Platons Dialog Phaidros, der die schon nicht mehr ganz junge Erfindung der Schrift als etwas kritisiert, das negative Folgen für das menschliche Gedächtnis zeitigt. Die Lehrlinge der Schrift, so der antike Philosoph, würden durch dieses erweiterte Gedächtnis bloß eingebildet, nicht aber weise. Überliefert ist uns diese Kritik der Schrift im Zeichen der Einbildung als ein performativer Widerspruch, der nur dadurch geglättet wird, dass Platon in seinem Text den Sokrates sprechen lässt. Ansonsten wird im Lichte der philosophischen Erkenntnis das Verdikt gegen die Welt der Sinne ausgesprochen: bekannt ist das sogenannte "Höhlengleichnis" aus Platons Der Staat, in dem die sinnliche Welt als unsicher und trügerisch verworfen wird. Die ihrer Sinnlichkeit verhafteten Menschen halten an die Wand geworfene Schatten für Abbilder der Wirklichkeit. Wahre Bildung aber hält sich an die Idee des Wahren und Guten statt an solche Schatten, sie verhält sich wie das strahlende Sonnenlicht zum flackernden, Schatten werfenden Höhlenfeuer. In der Folge bewegt sich die Text um Text produzierende abendländische Philosophie wie selbstverständlich im Reich der Schrift und des Drucks, ohne diese kulturtechnische Bedingung der Möglichkeit ihrer Existenz zu thematisieren. Die Verschriftung von Denkarbeit und Erkenntnis als Kopplung von Episteme und Druckkultur kennt keine Alternativen - ausser dem flüchtigen Dialog oder der mystischen Schau; philosophiert wird in nüchternen Texten, Denken mündet im Buch als seiner Form. Dass die Entwicklung des Denkens gänzlich unter das Paradigma einer Herstellung von propositionaler Begrifflichkeit in Texten gestellt wird, kommt in einem strikt durchgehaltenen Bilderverbot zum Ausdruck. So wehrt sich Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft strikt gegen alle "abgezogene Darstellungsart", um unter Berufung auf die "erhabene Stelle im Gesetzbuche der Juden" - eben das alttestamentarische Bilderverbot - gegen die didaktische und vermeintlich aufklärende Verwendung von Bildern zu wettern. In "Bildern und kindischem Apparat" suche Hilfe nur, wer nicht auf die Kraft großer sittlicher Ideen vertraue. Und hier nimmt Kant eine geradezu ideologiekritische Wendung: "Daher haben auch Regierungen gerne erlaubt, die Religion mit dem letzteren Zubehör [sc. Bilder und kindischer Apparat - F.H.] reichlich versorgen zu lassen, und so dem Untertan die Mühe, zugleich aber auch das Vermögen zu benehmen gesucht, seine Seelenkräfte über die Schranken auszudehnen, die man ihm willkürlich setzen, und wodurch man ihn, als bloß passiv, leichter behandeln kann." (Kant 1974, Bd.X, A123) Die Herstellung von Publizität zur Garantie einer Rechtsordnung, weiters die Bedingung der Öffentlichkeit für die Geltungsansprüche wissenschaftlichen Argumentierens hat Kant in seinen Schriften zur Anthropologie (1784: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1795: Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf - vgl. Kant 1974, Bd.I) durchaus thematisiert. Die Frage der Abhängigkeit des menschlichen "Geistes", sofern dieser medialen Bedingungen seiner Möglichkeit in Form von Kultur, Sprache, Symbolverwendung, oder Technik unterliegt, bleibt dieser grundlegenden Philosophie jedoch unerheblich. Es wird in jener Zeit das menschliche Weltverständnis in die Frage nach einem möglichst perfekten Welttext aufgelöst (Blumenberg 1983). Hier liegen auch die Wurzeln der gegenwärtigen konservativen bis apokalyptischen Kulturkritik, die neue Medien lediglich als Agenten eines drohenden Untergangs des Abendlandes (Postman 1999) wahrnimmt und die Bedingungen der Produktion und Verbreitung von Wissen exklusiv mit Buchdruck und Druckkultur gleichsetzt (zum historischen Überblick vgl. Burke 2001). |
||
|
4 - Medienwirklichkeiten und der Begriff "Medium" Den Einzug der Bilder in unsere Kultur konnte jedoch kein religiöses oder akademisches Verbot verhindern. Mit der Fotografie beginnt im neunzehnten Jahrhundert definitiv der Auszug aus der Gutenberg-Galaxis: es handelt sich um eine Medienrevolution, mit der nun die Gegenstände "sich selbst in unnachahmlicher Treue" malen. Damit entsteht eine subjektlose Kunst, die gleichwohl "unaufhaltsam den Verstand und die Einbildungskraft" anspricht, wie Alexander von Humboldt 1839 aus Paris berichtet (zit. nach Hörisch 2001, 227f). Diese die Weltwahrnehmung und -interpretation verändernde Technik wäre ein philosophisches Thema, aber noch hundert Jahre später gibt es die Verwunderung, dass die der medialen Innovation der Fotografie naheliegenden "philosophischen Fragen ... jahrzehntelang unbeachtet geblieben sind." (Walter Benjamin 1931, in Benjamin 1977, 47). Die Wirkung dieser medialen Apparatur auf Verstand und Einbildungskraft revolutioniert nämlich durch neuartige "taktile Rezeption" nicht nur die Ästhetik, sondern alle Grundbefindlichkeit des Menschseins "im Land der Technik", in dem der "apparatfreie Aspekt der Realität" (Benjamin 1977, 31) illusionär geworden ist - den Medienwirklichkeiten lässt sich nicht länger im Namen authentisch menschlicher Erfahrung entfliehen. Diese Beobachtung impliziert einen weiteren wichtigen Aspekt: Neue Technik schafft neue Wirklichkeiten - der konstruktivistische Aspekt wird dabei gerne überbetont, während sie doch nicht nur neue Welten und neue Entwürfe erlaubt, sondern auch die Reinterpretation des Vorhandenen. Benjamin hat vom optisch Unbewußten gesprochen, das speziell die Fotokamera enthüllt, und gerade diese neue Sichtbarmachung bezieht sich auf vorhandene Welten. "Medien sind damit nicht nur für die Konstruktion neuer Wirklichkeiten und zweiter Naturen, sondern auch für Einblicke in alte Wirklichkeiten und erste Naturen zuständig." (Rieger 2000, 170). "Medium" selbst wird erst im zwanzigsten Jahrhundert zu dem Begriff, den wir heute für medientechnische Funktionen des Codierens, Speicherns und Übertragens verwenden. Zuvor hatte dieser Begriff eine andere Bedeutung, etwa den einer Person als Medium im Rahmen parawissenschaftlicher Praktiken auf der Suche nach Zwischenwelten (Darnton 1983). Ein Indiz dafür, dass der Begriff des Mediums im Sinne von Durchlässigkeit für etwas verwendet worden ist, findet sich in Georg W. F. Hegels Wissenschaft der Logik von 1812 - fast beiläufig wird da erwähnt, dass so, wie das Wasser im Körperlichen die vermittelnde Funktion eines Mediums hat, im Bereich des Geistigen die Zeichen bzw. die Sprache diese mediale Funktion übernehmen (Hegel 1970, Bd.6, 431). Das Medium ist ein Tor zur Welt des Symbolischen; die Medien hingegen bleiben eine ganz profane Angelegenheit: das Zeitungslesen bedeutete dem Denker "eine Art von realistischem Morgense-gen" in der Welt des Geistes (Hegel 1970, Bd.2, 547), die sich als solche jedoch von medienpragmatischen Fragen vorerst noch gänzlich unberührt wähnt. Die Praxis der Medienwirklichkeit, die erst nach Hegel (etwa ab Mitte des neunzehnten Jahrhunderts) eine "neue" zu werden beginnt, schlägt sich in der klassisch genannten Philosophie vorerst nicht nieder. Hier lässt sich für den gegebenen Kontext eine relevante Unterscheidung gewinnen: Medienphilosophie ist kein Ansatz, der die Philosophiegeschichte danach abklopft, was einzelne berühmte Philosophen über die Medien zu sagen hatten. Sie kann höchstens als philosophischer Anspruch an die Gegenwart he-rangetragen werden, ganz in dem Sinn, dass - in Anlehnung an eine Bemerkung von Gilles Deleuze zum Kino - angesichts einer neuen medialen Praxis der Bilder und Zeichen es Sache der Philosophie wäre, ihre Begrifflichkeit wenigstens darauf einzustellen. Philosophie hat eine doppelte Herausforderung: ihre eigene mediale Bedingtheit, aber auch die Medien selbst als Objekt zu thematisieren. Zu der Einsicht, dass Sprache und Denken sich interdependent entwickeln, fanden schon die Philosophen des Aufklärungszeitalters, allen voran Johann Gottfried Herder (Vgl. in Borsche 1996, 215ff). Dass auch unser Schreibwerkzeug an unseren Gedanken mitarbeitet, war eine ironische Einsicht Nietzsches, der damit rückwirkend auch zum Idol einer medienmaterialistischen Wende in der Philosophie geworden ist (Kittler 1986, 293f). Für diese Position ist die Rezeption zumeist französischer postmoderner Theorien wichtig (Frank 1983); möglicherweise mussten die neuen Medien aber auch erst eine Generation von Theoretikern form(at)ieren, damit sich gegen die herrschenden akademischen Diskurse wie Hermeneutik, Handlungstheorie und Kritische Theorie neue medientheoretische Positionen durchsetzen konnten (Hörisch 1997). Medienphilosophie umfasst im weiteren die Frage danach, was Philosophie unter neuen Medienbedingungen überhaupt noch ist. Frei nach Hegel nimmt Philosophie die Aufgabe wahr, das, was an der Zeit ist, in Gedanken zu erfassen (Hegel 1970, Bd.7, 26). Medienphilosophie muss also die Medienrevolutionen reflektieren, die den Weg in eine telematische Gesellschaft geebnet haben, um gerade in der Differenz zu klassischen bewusstseins- und sprachphilosophischen Ansätzen einen entscheidenden Schritt über die typografische Vernunft hinauszugehen. Während das akademische Philosophieren die neuen audiovisuellen Speicher- und Übertragungsmedien, die seit dem neunzehnten Jahrhundert auch die menschliche Wahrnehmung zu verändern beginnen, und damit die Medienwirklichkeiten im wesentlichen beiseite lässt, kommt es erst im zwanzigsten Jahrhundert zu gelegentlichen (also kaum systematischen) medientheoretischen Einlagerungen in den philosophischen Diskurs, die fast immer eine kulturkritische Färbung annehmen. |
||
|
5 - Sprache, Kultur, symbolische Form Bevor wir uns diesen näher zuwenden, werfen wir einen kurzen Blick auf die philosophische Tradition der Moderne. Ihre zentrale Frage dreht sich in verschiedenen Fassungen um das Problem der Wahrheit, bzw. darum, was wir von der Welt erkennen können. Die Erkenntnistheorie kennt als Problem die grundsätzliche Mediatisiertheit aller Dinge, das heißt alles, was wir an der Welt erkennen können, ist uns in irgend einer Form vermittelt. Immer wieder geht es um diese ursprüngliche Differenz, die das Menschsein auszeichnet, seit die Menschen im Lauf der Evolution aus der Natur herausgetreten sind: die Welt ist an sich nicht so, wie wir sie für uns wahrnehmen. Erkenntnis bedeutet immer auch ein gewisses konstruktives Moment; je nachdem, was zu ihr beiträgt - ob nun Sinneswahrnehmung oder eine Theorie - habe wir verschiedene Welten vor uns. Der Verdacht, dass die Sinne grundsätzlich trügen, hat René Descartes dazu bewogen, sie als eine gesicherte Grundlage für Erkenntnis überhaupt auszuschließen. Seine Grundlage war rationalistisch: die Selbstgewissheit im Vollzug des Denkens. Immanuel Kant verlegt in seiner theoretischen Philosophie (Kritik der reinen Vernunft, 1781) die Frage nach der entscheidenden Strukturierung des Weltbezugs zwar ganz in das Subjekt hinein; die Bedingungen jedoch werden transzendental angelegt - was bedeutet, dass sowohl die sinnlichen wie auch die reflexiven Voraussetzungen für alle Menschen (Kant sagt: Vernunftwesen) gleichen Schranken unterliegen, welche die Welt der Erscheinungen formieren. Wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht wirklich, da sie immer nur in einer bestimmten Form für uns gegeben sind. Wie die Konstellation von Welt einerseits, Mensch andererseits, und den zwischengeschalteten Symbolsystemen bis hin zu kulturellen und technischen Programmierungen zu denken sei, das bleibt etwas pauschalisierend ausgedrückt eines der prominentesten philosophischen Probleme der Moderne. Die sprachphilosophischen Kritiker Kants (vor allem Herder und Wilhelm von Humboldt) freilich machen darauf aufmerksam, dass die vermeintlich autonome Vernunft ihren bedingenden Rahmen hat, da sie sich immer innerhalb einer Kultur und in einer Sprache formiert und damit von einer bestimmten Überlieferung abhängig ist, die wiederum das jeweilige Weltbild formt. Sprache als das Medium, in welchem sich Gedanken überhaupt erst bilden können, wird dabei immer weniger als Ausdruck der Realität von Dingen gesehen und immer mehr als Ausdruck einer Relation der Dinge zu den Menschen sowie der Menschen untereinander, wie etwa Friedrich Nietzsches sprachtheoretischer Text Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne (1873) belegt. Zwar hat Nietzsche sein Bonmot vom Schreibwerkzeug, das dem Denken Bedingungen schafft, nicht ausgearbeitet; interessant aber ist allemal, wie philosophisches Denken mit Annäherung an das zwanzigste Jahrhundert verstärkt sprachkritische Züge annimmt (zur weiteren Ausdifferenzierung sprachtheoretischer Ansätze vgl. Krämer 2001). Eine im philosophisch-disziplinären Sinn undogmatisch angelegte ideengeschichtliche Spurensicherung zeigt die Motive, nach denen die sich formierende Sprachphilosophie gelegentlich in Kultur- und Mediengeschichte umschlägt (Kittler 2000). Es ist die kulturphilosophische Kontextualisierung der abstrakt konzipierten Begriffe von Vernunft und Erkenntnis, die uns auf den Weg zu einer Medienphilosophie führen. In den frühen zwanziger Jahren publizierte der damals in Hamburg lehrende Philosoph Ernst Cassirer sein dreibändiges Werk zur Philosophie der symbolischen Formen (Cassirer 1997). Darin vollzieht sich definitiv die sprachphilosophisch lang angekündigte Wende hin zum Symbolischen. Dabei werden Sprache und Mythos neben dem Problem der philosophischen Erkenntnis und der wissenschaftlichen Erklärung als eigenständige Narrative im Prozess der Menschwerdung thematisiert: der Mensch gilt fortan nicht bloß als rationales Wesen, sondern als animal symbolicum. Damit werden kulturtechnisch bedingte Erfahrungsmodalitäten des Menschen herausgearbeitet und in einer Theorie des kulturellen Sinnverstehens systematisch begründet. |
||
|
In diesem Übergang von einer philosophischen Erkenntnistheorie zu einer kulturphilosophischen Symboltheorie, die im übrigen auch biologische und ethnologische Forschungsergebnisse einbezieht, definiert Cassirer die kulturellen Objektivationen als ein "artifizielles Medium", das sich zwischen den Menschen und die Welt schiebt. Der Mensch hat es nie mit den wirklichen Dingen zu tun, sondern mit mediatisierter Wirklichkeit, und das heißt mit symbolischen Formen wie Sprache, Mythos, Kunst, Religion, Wissenschaft. Es sind diese Symbolsysteme, die seine Wirklichkeit erschließen und ihr immer wieder neue Dimensionen hinzufügen.[1] |
Anm.1 - Fragen der nichtbegrifflichen Erkenntnis
aus sinnlichem Wahrnehmungs-vermögen können hier aus Platzgründen nicht näher ausgeführt werden:
die Medienästhetik verdiente ihren eigenen
Beitrag. Vgl. einführend zur philosophischen Ästhetik Seel (2000);
zur Geschichte und Theorie audiovisueller Wahrnehmungs-formen
Schnell (2000); neue Ansätze zur Bildwissenschaft bei Belting (2001). |
|
|
6 - Phänomenologischer Ansatz Unsere alltägliche Erfahrung ist durchsetzt mit Codes und Normen, Konstrukten und Simulationen, Paradigmen und Theorien. Was aber ist es, das sich der Erfahrung selbst zeigt, und wie lässt sich dies, noch vor aller Theorie, beschreiben? Die Suche nach einer Urform der Erfahrung, die Analyse der nichtmediatisierten Wirklichkeit oder der Versuch, an ihren Phänomenen zu arbeiten, formt ein Denken oder besser eine philosophische Methode, die sich Phänomenologie nennt. Es war Edmund Husserl, der ab ca. 1913 die Idee der Phänomenologie ausformte, und zwar als eine Archäologie der Erfahrung, die auf die "Sachen selbst" zielt (Husserl 1993). Methodisch soll dazu in einem Verfahren der Reduktion von allen Vorurteilen und kulturellen Werten etwas "Eigentliches" freigelegt werden, das als Sinnfundament funktioniert. Erst in Betonung einer Intentionalität des Ego und als Funktion des Bewusstseins werden Sinn und Bedeutung als solche konstituiert. Die Arbeit an den Phänomenen soll ebendiese von ihren kulturellen und geschichtlichen Überlagerungen befreien. Wenn Husserl feststellt: "Die 'gesehenen' Dinge sind immer schon mehr als was wir von ihnen 'wirklich und eigentlich' sehen" (Husserl 1977, 55), dann könnte man diesen philosophischen Versuch einer Erzeugung von Direktheit (um nicht zu sagen: einer Reinigung) durchaus als einen Kampf werten, sich der emergierenden Medienwirklichkeit zu entwinden. Konkret war bei Husserl nur die Rede von Idealitäten, die eine moderne Naturwissenschaft der wirklich erfahrenen und erfahrbaren Welt - die er unsere alltägliche Lebenswelt nannte und diese als das vergessene Sinnfundament der Naturwissenschaft bezeichnete - unterschiebt (Husserl 1977, 52). Von Medien und ihrer symbolischen Überformung dieser Lebenswelt bis hin zur Verdichtung einer sekundären Realität der simulierten Wirklichkeiten war zu jener Zeit allerdings noch nicht die Rede. Erst Flusser sollte diesem methodischen Versuch unter Bedingungen einer neu kodifizierten Welt eine ganz andere Färbung geben: Phänomenologie als Absage an die Illusion, dass hinter der medialen Oberfläche sich etwas Ursprünglicheres verberge (vgl. dazu weiter unten, Abschnitt 10). Nicht als positive Lehre, sondern als methodischer Ansatz wurde die Phänomenologie zu einer wirkungsmächtigen Grundlage medienphilosophischer Theoriebildung. Als prominentester Schüler Husserls wagt Martin Heidegger den Versuch, jenen Erfahrungsboden noch tiefer zu legen, um in seiner Fundamentalontologie ein Sein zu beschwören, welches in Eigentlichkeit hinter den Überformungen durch menschliche und kulturelle Aktivitäten (Dasein in Form von Technik oder Gestell, vgl. Heidegger 1962) waltet und nur durch Lichtungen (wie in der poetischen Sprache) erahnt werden kann. Nicht als Vermittlerin zwischen Ich und Welt - und schon gar nicht als Kommunikationsmedium - wird Sprache dieser Philosophie zentral als jene Instanz, über die sich weder das Ich noch die Welt, sondern ein Anderes erschließt, einem ästhetischen Versprechen ähnlich, das durch die Technik der Reproduzierbarkeit allerdings durchkreuzt zu werden droht. Die moderne Technik jedenfalls depotenziert alles Menschliche, und der Mensch meistert nicht das Wesen der Technik, da in ihr ein Etwas sich äußert, das alles menschliche Tun und damit auch den kritischen Eingriff hinter sich lässt. |
||
|
7 - Nicht Sein, nicht Schein: Günther Anders Die Einwirkung von Technik und Medien im Sinne einer zweiten industriellen Revolution findet ihren Niederschlag in der negativen Anthropologie von Günther Anders, der nach den Alltagserfahrungen aus dem amerikanischen Exil die Massenmedien Rundfunk und Fernsehen als einer der ersten Philosophen überhaupt explizit thematisiert hat: Die Welt als Phantom und Matrize. Bemerkenswert an diesen aus den vierziger/fünfziger Jahren stammenden "philosophischen Betrachtungen über Rundfunk und Fernsehen" ist die Berücksichtigung des technischen Aspekts der Übertragung, der jedem ästhetischen Scheincharakter eine eigene Form der Realität zukommen lässt: weder Bild noch Wirklichkeit, besteht jedes gesendete Ereignis in einer "ontologischen Zweideutigkeit" der zugleich gegenwärtigen und abwesenden Form - es ist weder Sein noch Schein - und versetzt die Menschen in eine künstlich erzeugte Schizophrenie (Anders 1980, 131 bzw. 135ff). Anders' Diagnose, die Jahrzehnte später noch Theoreme zur Simulation beflügeln sollte, attestiert dem modernen Menschen im Vergleich zu seinen technischen Produkten eine spezifische Antiquiertheit, die er als "prometheische Scham" erfährt. Auf diese Scham, geworden statt gemacht zu sein, reagiert der moderne Mensch mit Styling, Kosmetik, Bodybuilding und auch mit seiner Unterwerfung unter die Apparatewelt. Die Welt der Medien beansprucht seine gesamte Wahrnehmung, "das Wirkliche wird zu Abbild seiner Bilder" (Anders 1980, 179). Die Menschen versuchen nicht nur, sich den medial erzeugten Vorbildern entsprechend zu formen, sondern entwickeln auch eine Ikonomanie, eine Bildersucht, die alles ausschließt, was nicht medial reproduziert (beispielsweise fotografiert) werden kann. Anders bringt die mediale Auflösung des Subjekt-Status philosophisch zur Sprache, indem er zeigt, dass Medienprodukte wie die Nachrichten keineswegs Realität wiedergeben, sondern diese erst konstruieren. Medien besorgen die Anlieferung von Weltbildern, um das Wirkliche oder "die Welt unter ihrem Bilde zum Verschwinden zu bringen" (Anders 1980, 154). Dabei gehen die Kategorien der Wahrnehmung über in den kollektiven Zwang eines Für-wahr-Nehmens dessen, was in Wahrheit für uns medial inszeniert worden ist. Fraglich bleibt, ob sich der technisch induzierten Selbstvernichtung als gesellschaftliches Kollektiv einerseits, der medialen Überbietung des Menschenbildes andererseits überhaupt noch entgegenwirken lässt. Anders zeigt einen totalitären Aspekt der Medienwirklichkeit auf, wobei ähnliche Argumente zum Tragen kommen wie die Anfang der vierziger Jahre, ebenfalls durch den Kulturschock der amerikanischen Emigration geprägten Ausführungen der Frankfurter Schule zur Kritik der Kulturindustrie (Horkheimer/Adorno 1997, 128ff). Bis in die Technik hinein, die sich auf eine Einweg-Kommunikation beschränkt, manifestiert sich laut ihrer Diagnose in den Massenmedien das Motiv der ökonomischen Ausbeutung aller menschlicher Ressourcen. Vor allem eins wird klargestellt: hier geht es nicht um eine Fortsetzung der Aufklärung, sondern um ihre Pervertierung zum Massenbetrug. Die philosophische Verarbeitung der Formen dessen, was kulturell erfahrbar ist, wird dabei auf eine Meta-Ebene verlagert, auf der es nur mehr einen generellen Verblendungszusammenhang zu konstatieren gibt. |
||
|
8 - Geschichte und mediale Dispositive: Harold A. Innis Gegen Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts lässt sich angesichts der Rolle, welche die audiovisuellen Medien zunächst in der westlichen Kultur übernommen haben, die Erfahrung nicht länger leugnen, dass ein Jahrhunderte währendes Monopol der Schriftkultur zu Ende geht. Von der zeitdiagnostischen Einsicht, dass "gedrucktes Material ... an Wirkungskraft einbüßt" (Innis 1997, 137) und auch für die gesellschaftliche Reproduktion nicht mehr unbedingt zentral ist, lässt sich aber nicht nur eine kulturapokalyptische Perspektive ableiten, sondern auch die durch eine differenziertere Geschichte der Kommunikationsverhältnisse untermauerte Erkenntnis, dass technischer und sozialer Fortschritt interagieren. Wie der kanadische Wirtschaftshistoriker Harold A. Innis 1949 feststellte, besitzen Medien eine Tendenz zur Realitätsmodulierung, da ihnen die Rolle der Verteilung von Wissen in Zeit und Raum zukommt (The Bias of Communication, vgl. in Innis 1997, 95ff). Medien zählen zu den großteils unbewusst wirkenden kulturellen Strategien und stehen in einem affirmativen Verhältnis zu politischer Herrschaft, die sich im geschichtlichen Rückblick als eher von deren Materialitäten abhängig erweist als von den durch diese vermittelten Inhalten. McLuhan sollte diese am historischen Material gewonnene Erkenntnis dann zum Slogan "das Medium ist die Botschaft" verdichten (McLuhan 1992). Innis entwirft eine Medientheorie der Zivilisation; welche epistemische Bedeutung Medien haben, wird hierbei in die Frage nach dem environmental technological conditioning übersetzt, wobei Sprache, Texte, Bilder und andere Kommunikationsmittel, etwa Stein in der Architektur, kein unverrückbares, sondern ein historisch kontingentes Gefüge bilden, von dem die sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen jedoch abhängen. Die Einführung neuer Medien, und damit kultureller Wandel, folgt dabei dem Muster einer sozialen Informationsverarbeitung.[2] "Wir können wohl davon ausgehen, dass der Gebrauch eines bestimmten Kommunikations-mediums über einen langen Zeitraum hinweg in gewisser Weise die Gestalt des zu übermittelnden Wissens prägt. Auch stellen wir fest, dass der überall vorhandene Einfluss dieses Mediums irgendwann eine Kultur schafft, in der Leben und Veränderungen zunehmend schwieriger werden, und dass schließlich ein neues Kommunikationsmittel auftreten muss, dessen Vorzüge eklatant genug sind, um die Entstehung einer neuen Kultur herbeizuführen." (Innis 1997, 96) |
||
|
Vor dem materialen Eigensinn der in einer Kultur eingesetzten medialen Dispositive und den damit verbundenen
Wissens- und Kommunikationsmonopolen (Staat, Kirche, Universität) ist eine gänzlich frei handelnde Subjektivität
nicht möglich. Die bei Innis aufgeworfene Frage nach einer Gram-matik der Medien ist medienphilosophisch brisanter,
als es die Selbstverständlichkeit der verkürzten Wiedergabe seiner Thesen vermuten ließe. Wie lässt sich die
ominöse "Macht der Technik, ihre Eigengesetzlichkeit der Nachfrage zu schaffen" (McLuhan 1992, 86), angesichts
der zunehmend undurchdringlicher werdenden Benutzeroberflächen noch plausibel dechiffrieren?
|
Anm.2 - Der Begriff Informationsverarbeitung etablierte sich erst mit den Computerwissenschaften
ab den fünfziger Jahren. Explizite Kategorien für eine informationstheoretische Betrachtung der Mediengeschichte
wurden jüngst in den Studien von Michael Giesecke entwickelt (Giesecke 1998, 945ff). |
|
|
9 - Medien als die neue Natur: Marshall McLuhan Zentral für Herbert Marshall McLuhans Ansatz war die These, dass die technische Entwicklung und damit die Medien der westlichen Kultur nicht notwendig einer Logik des Zerfalls folgen müssen: der Niedergang einer bislang gesellschaftsprägenden Buchkultur kann auch ein Aufgang neuer Sinnlichkeiten bedeuten, anstelle der Literalität zeichnet sich eine neue Oralität ab (Pop- und Rockmusik). Die Schrift- und Druckkultur "opfert Welten von Bedeutungs- und Wahrnehmungsinhalten" (McLuhan 1992, 83), deren mögliche Rückeroberung in einer Zeit neuer Medien und Anwendungen ansteht. Beeinflusst vom britischen New Criticism, interessierte sich McLuhan zunächst für die Volkskultur des industriellen Menschen und analysierte ohne methodische Strenge, aber mit viel analytischem Scharfsinn Mediensujets wie Filmplakate, Werbeanzeigen, Comics, oder auch die Titelseite der New York Times, die wahlweise als symbolistische Landschaft oder als Jazzpartitur vorgeführt wird. Der Anspruch dieser 1951 publizierten Traumanalyse des kollektiven Bewusstseins war kulturkritisch aufklärend: "Wir leben in einem Zeitalter, in dem zum ersten Mal Tausende höchst qualifizierter Individuen einen Beruf daraus gemacht haben, sich in das kollektive öffentliche Denken einzuschalten, um es zu manipulieren, auszubeuten und zu kontrollieren." (McLuhan 1996, 7)Aus der Kritik der medialen Überformungen einer Alltagkultur, welche die Manipulation öffentlichen Denkens anprangert, folgt aber auch die Einsicht in die Ausdruckskraft der populären Kultur, die zunehmend einem vorindustriellen Acoustic space gleicht und, wie das Beispiel Fernsehen zeigt, neue Taktilitäten entwickelt, die letztlich eine Auflösung der Buchkultur als universal verbindlicher Form kultureller Reproduktion bedeutet (McLuhan 1962). Der kritische Theoretiker kann nicht länger distanzierter Beobachter sein. Die Erforschung der elektronischen Umwelt provoziert Involvierung und eine immersive Grundhaltung: "Wir sind jetzt gezwungen, neue Techniken der Wahrnehmung und der Beurteilung zu entwickeln, neue Wege, um die Sprachen unserer Umwelt mit ihrer Vielfalt an Kulturen und Wissenszweigen lesbar zu machen." (McLuhan 1997, 75) |
||
|
Er überrascht schon lange vor seinen als Provokation empfundenen Hauptschriften mit der Aussicht auf ein
"Erwachen aus dem historisch konditionierten Alptraum der Vergangenheit" mittels neuer Technologien.[3] Wahrnehmungs- und
Urteilsformen, so McLuhan, müssten in einer Überwindung des
typographic cultural bias neue Formen zulassen, um neue Decodierungen zu erlauben. Eine damit in Aussicht gestellte
neuartige "organische Einheit" (McLuhan 1992, 396) bedeutet die Rückkehr zu einer vorindustriellen Logik, und damit die
Wiederaufnahme von Momenten der Vergesellschaftung, wie sie in oralen Kulturen bestanden haben. Die neuen Medien der
Informationsverarbeitung dekonstruieren die spezifische Literacy einer Kultur, die auf Voraussetzungen des
phonetischen Alphabets und des Drucks gebaute Form der Zivilisation. Die Electric simulation der Medienwirklichkeit hingegen ist ein
Bewusstseinsvorgang, oder besser die Ausweitung des Bewusstseins über die Dimensionen des Sprachlichen hinaus in eine Kultur der
Oberflächen. Doch dann wird klar: Medien schaffen neue symbolische Ebenen, und generieren völlig neue Umwelten - "The new media", sagt
McLuhan in einem seiner vielen Interviews, "are not bridges between man and nature, they are nature". Dass Medien die Wirklichkeit nicht
wiedergeben oder vermitteln, sondern diese erst definieren, das hat McLuhan in aller Radikalität vorgeführt. |
Anm.3 - Dieses Zitat (McLuhan 1997, 69) aus seinem Essay "Kultur ohne Schrift" entstammt der von McLuhan
mit herausge-gebenen Zeitschrift Explorations Vol. 1, Dec. 1953, und erschien 1997 zum ersten Mal in
deutscher Übersetzung. Dass etwa auch The Mechanical Bride, sowie die Schriften von Innis in einer Auswahl
erst 1996 vorlagen, ist bezeichnend für die selektive Rezeptionslage im deutschen medientheoretischen Diskurs.
|
|
|
In Understanding Media schließlich geht es schließlich um das Ende der Linearität durch die Rückkopplungen
der "elektrischen Informationsbewegung" Automation und Kybernation (McLuhan 1992, 393ff). Lange
vor dem Diskurs der Postmoderne zeigte McLuhan theoretisch auf, welche Rolle Information, Kommunikation und
Wissen für die Reproduktion der Gesellschaft spielen und wie Kultur und Technologie konvergieren. Dabei
entsteht eine neue Kultur der Information. Die medientechnologische Produktivkraft erzeugt nach der
Explosion als Grundmotiv einer energetischen Technik der Industriegesellschaft eine implosive Grundhaltung, nach
der die Muster des Fortschritts neu zu denken sind. Information aber definiert Unterschiede [4], sie hat
keine Substanz sondern bestimmt Relationen. Nicht Konsens ist das Ziel von Kommunikation, sondern
Kollektivierung, nicht Verständigung, sondern Wahrnehmungsverschiebung und Übersetzung
(Medien sind hier Metaphern des Vermögens, "Erfahrung in neue Formen zu übertragen", McLuhan 1992, 74). Der
Mensch als humanistische Projektion souveräner Subjekte sinkt dabei herab zu einem "Servomechanismus" der
jeweiligen Techniken, die zur Anwendung kommen - und ist bald nicht mehr als ein bloßes "Geschlechtsteil
der Maschinenwelt" (ebd., 63).
|
Anm.4 - Es war Gregory
Bateson, der in seinen Studien zur Komplexität der
Beziehung von Erkenntnis- und Umwelt-strukturen wichtige Grundlagen
für eine kybernetisch-systemtheoretische Auffassung von
Kommunikation geschaffen hat. Sie erlaubt es, die geistige Welt
jenseits von Inhalts-aspekten als eine "Welt der
Informationsverarbeitung" zu sehen
(vgl. Bateson 1985, 583).
|
|
|
10 - Schrift, Rhizom, Netz: Foucault, Derrida, Deleuze/Guattari, Serres Dass eine Kultur auch auf andere Codierungen als die des phonetischen Alphabets gebaut sein kann, diese Relativierung der Rolle von Schrift und Druck - das Ende der Gutenberg-Galaxis - ist das wohl bekannteste kultur-philosophische Vermächtnis McLuhans. Damit wird nicht nur das 'Betriebssystem' der Welt des Geistes und damit der abendländischen Werte bloßgelegt, sondern auch die Idee des menschlichen Subjektes in die Abhängigkeit von den historisch kontingenten Kulturtechniken gesetzt. Ganz in diesem Sinne, wenn auch vordergründig ohne Bezug auf den medienwissenschaftlichen Diskurs, kommt es in den sechziger Jahren zu einer Reihe von philosophischen Publikationen, die ein Denken vorbereiten, das mit der Hilflosigkeit jeder Etikettierung später als 'postmodern' bezeichnet wird. Aus seiner Beschäftigung mit der Geschichte von Denksystemen kommt Michel Foucault zu dem Schluss, dass es jeweils fundamentale Dispositionen des Wissens gibt. Da diese sich mit der Zeit ändern, ist auch das, was letztlich in das Archiv einer Kultur eingeht, keineswegs gleichbleibend. Die Positionen des Subjekts, das Aussagen trifft, sind sehr variabel; nur die Diskurse oder die Formationen und Regelmäßigkeiten der Aussagen sind wissenschaftlich zugänglich. Sogar die Rolle des Subjekts ist eine transitorische: lediglich zwischen verschiedenen Formen der Sprache - die in der Neuzeit mit ihrer Rolle bricht, in Form der Schrift eine Repräsentation der Dinge zu sein - "zwischen zwei Seinsweisen der Sprache" also formiert sich die Gestalt des Menschen; eine Gestalt, die gewiss auch wieder verschwinden könnte, wenn jene Dispositionen verschwänden (Foucault 1971, 461f). Sprache, die in Erscheinung treten kann, ist Schrift. Schrift aber, so Jacues Derrida in seiner Grammatologie, besteht eigentlich nicht aus Zeichen, die für eine Sache stehen, sondern aus einer Spur, die in einem Gefüge von Verweisungen gezogen wird (Derrida 1974). Derridas Theorie der Schrift erkundet ein experimentelles Denken der Divergenzen, die den Sinn von Kommunikation zugunsten ihrer Effekte, wie etwa der Schreibpraxis und der Inszenierung von Texten, hintanstellt ("Signatur - Ereignis - Kontext", vgl. in Derrida 1976). ). Derridas zentrale These vom Logozentrismus des westlichen Denkens entwirft die medienphilosophisch relevante These vom Primat der gesprochenen Sprache vor dem Hintergrund einer spezifischen "Schriftvergessenheit" - sie stellt gewissermaßen McLuhan auf den Kopf, der durch die audiovisuellen Medien eine neue Oralität heraufziehen sah. Es gelte, die historische Verdrängung zu vergegenwärtigen: es gibt kein Gesprochenes, das nicht von einem "Schriftfonds" zehren würde. Unsere intuitive Auffassung von der Schrift, die sich als Fixierung des gesprochenen Wortes und damit auf die Sprache folgt, wäre demnach eine falsche Historisierung: Sprache ist ein Effekt der Schrift, es gibt "kein sprachliches Zeichen, das der Schrift vorherginge" (Derrida 1974, 29). Dass Schreiben weniger mit "bedeuten" als mit dem Besetzen und "Kartographieren" von Terrain zu tun hat, bestätigen eine Theoriegeneration später Gilles Deleuze und Felix Guattari in Rhizom, der Einleitung des zweiten Teils ihrer monströsen Theorie der Wunschmaschinen. Rhizome, also Geflechte und Gewebe zu bauen, das steht hier als eine metaphorische Forderung nach einer Neudeutung der Aussagenproduktion jenseits des überholten Relationsgefüges von Welt, Buch, und Autor (Deleuze/Guattari 1992). Der Begriff des Rhizom repräsentiert ein Denkmodell der Vielheiten, das gegen die binäre Logik gerichtet ist; gegen das klassische Denken nach dem Muster des Baumes und der Bifurkationen, und gegen Linearität und falsche Einheiten. Von medienphilosophischer Relevanz ist hier vor allem die implizite Kritik an der Informatik, sowie am mathematischen Ingenieursmodell der Kommunikation. Diese poststrukturalistische Theoriebildung kommt wuchernd und ausufernd daher, ihre Themen sind heterogen und verkör-pern als Ensemble den Anspruch, über die maschinentechnische Homogenisierungen hinauszugehen, welche die Kultur des Industriezeitalters immer noch mit einer Kultur der Digitalisierung verbindet. "Jeder Punkt eines Rhizoms kann (und muss) mit jedem anderen verbunden werden" (ebd., 16). Diese rhizomatische Verflechtung, in der Verbindungen auch über unter-schiedlichste Codierungen funktionieren, entspricht der Heterogenität einer changierenden medienkulturellen Matrix. Die eingeübten Kategorien und cartesianischen Dualismen wie Mensch und Technik, Jahrhunderte lang als ontologische Grundkonstanten verstanden, werden durch Konzepte einer neuen Medienwirklichkeit abgelöst, die "keinen radikalen Einschnitt zwischen Zeichenregimen und ihren Objekten" mehr erlauben und eine multimediale Dezentrierung von Sprache "auf andere Dimensionen und Register hin" verlangen (ebd.). Die Übertragung zwischen Punkten ist nur ein Sonderfall der möglichen Bezugnahme; Unordnungen wie Interferenzen und Verteilungen (Serres 1987, 1991) bestimmen die kommunikativen Verhältnisse. Es ist wichtig, angesichts der Engführungen einer mathematischen Theorie der Informationsübertragung in Kommunikationskanälen (Claude Shannon) noch darauf zu verweisen, dass im französischen Diskurs bereits in den frühen sechziger Jahren eine ebenfalls mathematisch begründete, auf einer Logik des Unscharfen beruhenden Philosophie der Kommunikationsnetze erarbeitet wurde. Michel Serres bestimmte das klassische lineare Übertragungsmodell, das Kommunikation als Austausch zwischen zwei unabhängigen Polen darstellt, als Sonderfall, der in der Wirklichkeit kaum zu finden ist (Serres 1991, 23). Der Realität entspricht viel eher ein zumindest dreidimensionales Netzwerk, in dem jeder Knoten notwendigerweise mit vielen anderen in Verbindung steht. Übertragung zwischen diesen Knoten ist wiederum nur ein Spezialfall der möglichen Bezugnahme, denn jeder Dialog beansprucht den Bezug auf einen ausgeschlossenen Dritten; Determination, Reflexion, Interferenz, Negation, Überschreitung - und all das Parasitäre - bestimmen den kommunikativen Vollzug. Diese auf moderne mathematische Axiome bezogene Netztheorie erlaubt in einer "Philosophie ohne Verteiler" (Serres 1987, 73) die strategische Distanzierung von den cartesianischen Dualismen wie Geist und Materie, Mensch und Technik. |
||
|
Diese auf moderne mathematische Axiome bezogene Netztheorie erlaubt in einer "Philosophie ohne Verteiler"
(Serres 1987, 73) die strategische Distanzierung von den cartesianischen Dualismen wie Geist und Materie, Mensch und
Technik. Die eingeübten Kategorien, Jahrhunderte lang als ontologische Grundkonstanten verstanden, werden durch
Bündel von Kraftvektoren abgelöst. So lassen sich auch die Zufälligkeiten der Kommunikation mathematisch begreifen,
ohne sie allerdings in der Realität berechenbar zu machen. Serres wählt in seinen Schriften Gestalten der antiken
Mythologie als Metaphern, um diese Komplexität begrifflich zugänglich zu machen. Der Philosoph wird damit selbst zu
jenem Boten, zum Übersetzer, den Serres nicht zufällig in der mythischen Figur von Hermes, dem Götterboten, als
symbolischen Träger aller Kommunikation vorstellt.[5]
|
Anm.5 - Vgl. F. Hartmann, Bernhard Rieder: Der Pirat des Wissens ist ein guter Pirat. Michel Serres im Gespräch |
|
|
11 - Kommunikologie: Vilém Flusser Menschliche Kommunikation ist negativ entropisch, das heißt sie ist in dem Sinn widernatürlich, als sie mit ihren künstlichen Wissens- und Informationsspeichern der natürlichen Tendenz zum Zerfall aller Formen entgegenwirkt. Sie schafft Komplexität, wo diese normalerweise abgebaut wird. "Die menschliche Kommunikation ist ein Kunstgriff, dessen Absicht es ist, uns die brutale Sinnlosigkeit eines zum Tode verurteilten Lebens vergessen zu lassen... Die Kommunikationstheorie beschäftigt sich mit dem künstlichen Gewebe des Vergessenlassens der Einsamkeit" (Flusser 1996, 10).Dieses aus nach bestimmten Codes verknüpften Symbolen bestehende Gewebe ist die zweite Natur, in der die Menschen leben. Aus dem Speichern und Übertragen von Information, einem genuin widernatürlichen Kunstgriff, wird ein quasi-natürlicher Code, die kodifizierte Welt. Die in ihrem Funktionieren unhinterfragte Welt ist mit dem alphabetischen Code in die Krise geraten; die Rede ist von einem radikalen Umbruch der Kommunikationsverhältnisse. Vilém Flussers Ansatz einer Medienphilosophie ist der Frage verpflichtet, was die Anbahnung einer telematischen Gesellschaft für die menschliche Kulturentwicklung bedeutet. Mit einfachen wie auch stark komprimierten Gedankengängen rekonstruiert Flusser die Menschheitsgeschichte als eine, die in zunehmender Abstraktion weg von der Natur und hin zu sich stets erneuernden Kulturformen führt. Dazu werden kulturanthropologische Ansätze von Herder bis Heidegger und McLuhan synthetisiert, während sich Flussers Thesen einer bestimmten Zuordnung dennoch entziehen. In den Einzelanalysen, brillant etwa die Versuche über Gesten im alltäglichen Kontext (Flusser 1994a), aber auch zu Medienphänomenen (Flusser 1993), die der phänomenologischen Methode verpflichtet sind, nehmen medienphilosophische Grundbegriffe wie Kommunikation und Information, aber auch Geschichte, Dialog und Diskurs neue und teils überraschende Färbungen an. Flussers Grundstimmung ist von der Hypothese getragen, "dass sich die Grundstrukturen unseres Daseins verwandeln" und dass eine Philosophie des Apparats und der nachgeschichtlichen Programmierungen erforderlich ist (Flusser 1983, 69ff). Demnach sind die kulturbestimmenden Codes nicht mehr alphabetisch bzw. rein alphanumerisch, sondern bestehen statt aus einer linearen Anordnung von Zeichen nunmehr aus Flächen (images). Die menschliche Einbildungskraft, die an den Prinzipien des Gutenberg-Zeitalters ausgebildet und geschult worden ist, kommt mit dem neuen, technoimaginären Code nicht zurecht und muss neu ausgebildet werden (Flusser 1993, 251ff). Aufgrund dieser Unbestimmtheit des Technoimaginären bleibt vorläufig unentschieden, ob dieser Umbruch der Codes eine repressive oder eine emanzipative Auswirkung auf die Gesellschaftsorganisation haben wird. Ob, mit anderen Worten, sich mithilfe der medialen Apparate eine fascistische (gebündelte, zentrierte) oder eine telematische (dialogische) Gesellschaft abzeichnet. Alles ist möglich - Flussers Rekonstruktion der Menschwerdung zeichnet einen unabgeschlossenen Prozess, ein evolutionistisches Projekt. Dieser Ansatz führt seine Theoriebildung jedenfalls nicht in die Verlegenheit, in kulturapokalyptischer Erstarrung zu verharren. |
||
Wie kam es laut Flusser zur Ausbildung dieser Textwelt, von der wir uns zugunsten neuer Horizonte verabschieden?
Das Lebewesen Mensch befindet sich ursprünglich im mehrdimensionalen Raum wie jedes andere Lebewesen. Die Befreiung
von Naturzwängen schafft sukzessive neue Möglichkeiten: eine Hand, die nicht mehr zum Gehen benötigt wird, kann
die Welt begreifen, ein Mund, der nicht mehr als Greiforgan dient, lernt sprechen.[6] Der Mensch tritt aufgrund
seiner Abstraktionsleistung aus der Naturverbundenheit heraus, wird zum symbolverwendenden Wesen und schafft sich
gleichzeitig durch die instrumentale Behandlung der Natur seine lebensweltliche Existenz, indem er aus der natürlichen
Welt heraustritt oder ek-sistiert.
|
Anm.6 - Vgl. hierzu das Werk des Paläontologen André Leroi-Gourhan (1995), der die gemeinsame Grundlage von Sprache und Technik in der Ko-Evolution von Werkzeug- und Symbolgebrauch unter Voraussetzungen einer veränderten neuromotorischen Organisation des Menschen belegt hat. |
|
|
Solche Existenz, eine unterste Stufe der Reflexivität, bildet sich eine magische Welt ein, indem sie sich ein Bild
von der Welt macht (sie sich einbildet, also nicht: diese abbildet - eine wichtige Unterscheidung). Werkzeuggebrauch
und Symbolverwendung öffnen eine neue Welt des Symbolischen, beides wird unter das Informieren gefasst. Durch
das Imaginieren von Natur entstehen Bilder, deren flächiger, zweidimensionaler Code mit der Zeit aber nach einer
Verdeutlichung verlangt, nach eindeutiger Lesbarkeit statt bloßer Deutbarkeit: So rekodieren Texte die Bilder.
Mit der Durchsetzung der Schrift wird der Code eindimensional, das Paradigma dieser zweiten großen Einbildung ist die
Linearität, das zeitliche Nacheinander im Symbolisierungsprozeß und damit das geschichtliche Prinzip. Beginnend mit dem Fotoapparat im neunzehnten Jahrhundert bahnt sich nach diesem Übergang von der magischen Imagination zur alphanumerischen Abstraktion ein weiterer Schritt an: nach Bildern und Texten werden nunmehr die Berechnungen vorherrschend, nach der Zwei- und Eindimensionalität die Nulldimensionalität der Punkte, aus denen sich das Mosaik der neuen Oberflächen als apparatgestützte Projektion auf die Welt zusammensetzt. Statt Subjekt von Objekten zu sein, wird der Mensch Teil eines Projektes, an dessen Horizont sich eine neue anthropologische Dimension einer dialogischen Existenz abzeichnet. |
||
|
Flusser setzte sein Bestreben in Gegensatz zur traditionellen Philosophie und fand dafür in Analogie zur
vorherrschenden Technologie und Biologie den Ausdruck Kommunikologie, um klar zu machen, dass der Brennpunkt
theoretischer Überlegungen zur kulturellen Situation sich definitiv verlagert hat (Flusser 1996, 242).[7]
Die neuen Medien sind Ausdruck einer Veränderung des kulturellen Programms, nicht Auslöser des Umbruchs.
Kommunikologie heißt aber auch, die neuen Codes zu akzeptieren, die Darstellungen in Bereichen erlauben, in d
enen "Worte nicht mehr kompetent sind" (Flusser 1994, 190). Dass auch diese Medienphilosophie eine geschriebene
blieb, und dass es weiterhin Bücher voller Worte geben wird, ist nicht unbedingt ein performativer Widerspruch,
sondern zeugt eher vom Respekt vor den Ungleichzeitigkeiten, den eine Jahrhunderte lang eingespielte Publizistik
ihren Autoren auch weiterhin abverlangt.
|
|
|
|
12 - Ausblick Ob mit dem in aller gebotenen Kürze skizzierten Überblick das abgedeckt ist, was sich gegenwärtig im Übergang von der Sprachphilosophie als das Spannungsverhältnis von Denken und Kulturtechnik thematisiert wird und sich unter dem neuen Titel einer Medienphilosophie vorstellt, bleibe dahingestellt. Wir sehen, dass der Begriff "Medium" weniger technisch denn als Metapher für ein Ordnungsprinzip zur Anwendung kommt, mit dem wir Publizität herstellen, damit Kultur und soziale Räume gestalten, denen nicht länger exklusiv das kulturelle Interface einer Schriftgesellschaft zum Vorbild dient (Hartmann 2000, 21). Es ist aus dieser Perspektive kein Zufall, dass die Kulturwissenschaft in jüngster Zeit den Übergang von einer bloßen Text- zu einer Medienwissenschaft als unumgänglich ansieht und auch in materialen Studien zu einer "anderen Moderne" sich nicht allein auf die Texte, sondern auf Mediengeschichten bezieht (Rieger 2000). Von medienphilosophischer Relevanz sind freilich auch verschiedene Ansätze der Gegenwartsphilosophie, die sich wie John R. Searle kritisch mit der Simulationslogik der Künstlichen Intelligenz beschäftigen (Searle 2001). Philosophische Skeptiker der Computerentwicklung wie Hubert Dreyfus melden sich jüngst wieder zu Wort, um überzogene Erwartungen an eine Kultur der Telepräsenz zu hinterfragen (Dreyfus 2001). Oder es werden pragmatische Reorientierungen im akademischen Diskurs, die sich aus einer recht spezialisierten Debatte um den Gegensatz von Repräsentationalismus und Konstruktivismus entwickelt haben, in Form einer pragmatischen Medienphilosophie (Sandbothe 2001) als neue "philosophische Disziplin" akademisch integrierbar zu machen versucht. Mike Sandbothe beansprucht, den linguistic turn der Gegenwartsphilosophie, mit dem die auf sprachliche Kommunikation gebauten menschlichen Kompetenzen für eine Theorie der Rationalität fruchtbar gemacht werden sollten, mit den neuen "technischen Möglichkeitsbedingungen" (d.h. Internet im alltäglichen Gebrauch) in Einklang zu bringen. Alternative Ansätze versuchen gar nicht mehr, solche Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Was sie versuchen, ist auch avancierte nonverbale Formen der Kommunikation - die Bilder, Sounds, Bewegungen der Künste - theoretisch zu integrieren, um damit eine semiotische Erweiterung im em-phatischen Sinn des Wortes zu leisten (Vogel 2001). Hier werden freilich auch zunehmend Beiträge relevant, die diese neuen Diskursordnungen abseits des akademischen Kontextes repräsentieren Disziplin" akademisch integrierbar zu machen versucht. [8] Jüngst hat Peter Sloterdijk den Versuch gewagt, den menschlichen Ort sphärologisch als eine Beschreibung von Innen- wie Außenverhältnissen im Prozess des Zur-Welt-Kommens neu zu bestimmen. Hier ist die Mediensphäre ebenfalls zentrales Thema - ob von der medialen Poetik der Existenz die Rede ist oder auch von homogenisierenden Praktiken und den kommunikativen Illusionen der sozialen Synthesis durch Massenmedien (Sloterdijk 1999). Wie in Interviews bereits angekündigt, steht auch von dieser Seite noch ein Medien-Buch zu erwarten, das in der philosophischen Debatte über den massenmedial integrierten Gesellschaftskörper - "was sich zusammen hört, was sich zusammen liest, was sich zusammen fernsieht, was sich zusammen informiert und aufregt" (Sloterdijk 1998) - Akzente setzt. Die Tragfähigkeit fast all dieser Ansätze ist noch offen und wird auch von weiteren Ausarbeitungen abhängen. Aus all dem folgt, dass wie immer die Anfänge der medienphilosophischen Fragestellung rekonstruiert werden, diesem grundlagenorientierten Diskurs zunehmend theoretische Orientierungsleistungen, auch hinsichtlich ästhetischer Fragen, pragmatischer Medienkompetenz sowie für praxisbezogenes Fachwissen, abzuverlangen sein werden. Während keineswegs Einigkeit darüber besteht, was Philosophie überhaupt ist - abseits der eher peinlichen Pose, mit der über Gott und die Welt populistisch "nachgedacht" wird - und welche Berechtigung sie in einer Zeit jenseits des Schriftmonopols hat, erscheint es einigermaßen paradox, von der Existenz einer Medienphilosophie zu sprechen (vgl. Münker/Rösler/Sandbothe 2002). Was eine kritische Annäherung im gegebenen Rahmen von sich transformierenden Kommunikationsordnungen jedoch leisten kann, das ist die Verortung einiger Positionen, die zur Reflexion der erkenntnistheoretischen Dimension von Medien und ihren Effekten auf Kultur, Gesellschaft, unser Denken und auf die Produktion von Wissen beigetragen haben. |
||
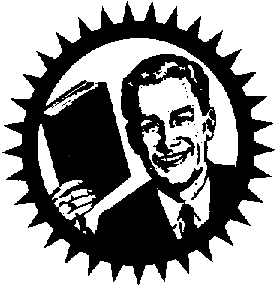 |
Literatur
|