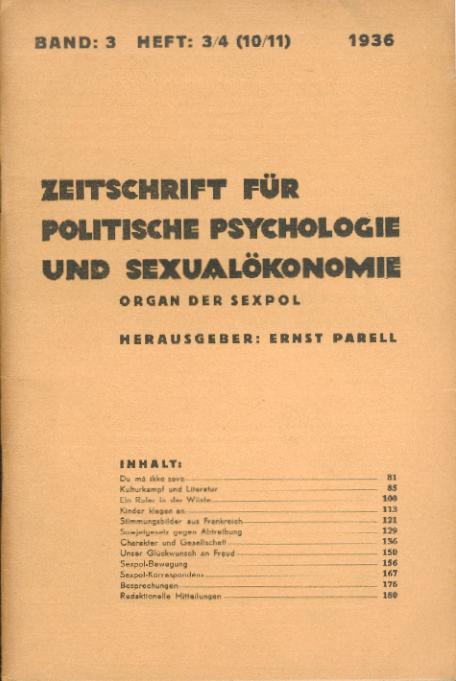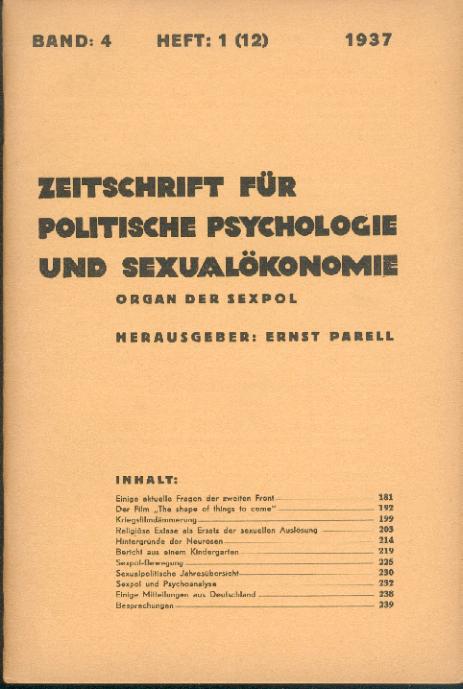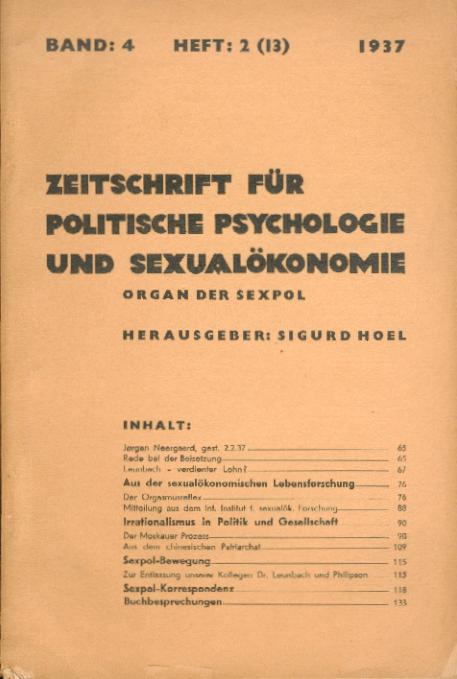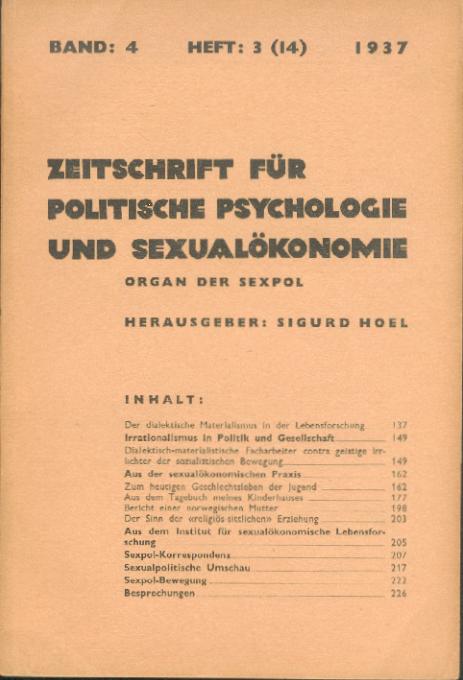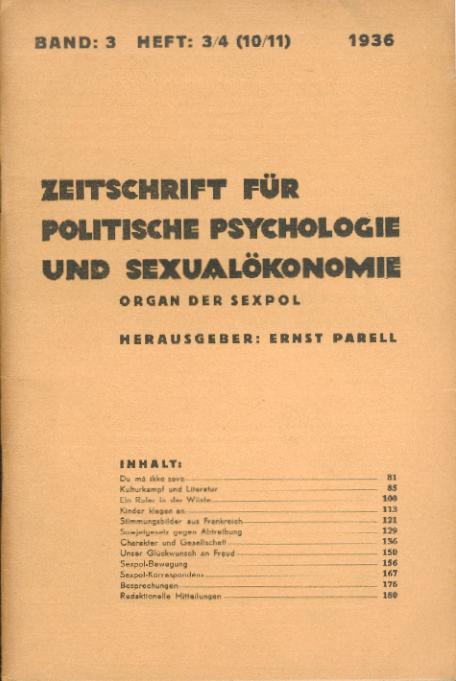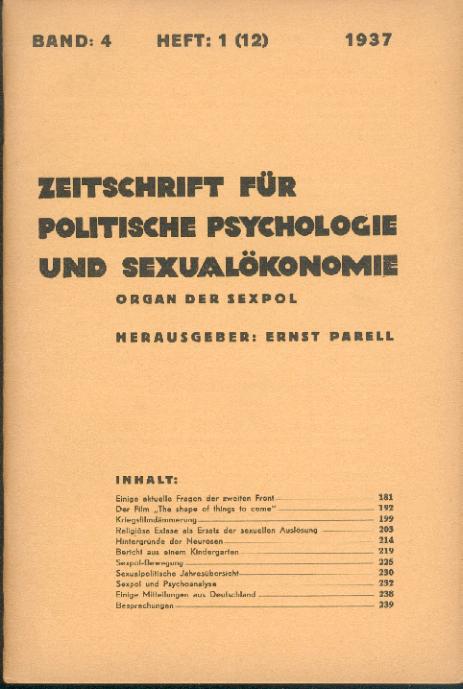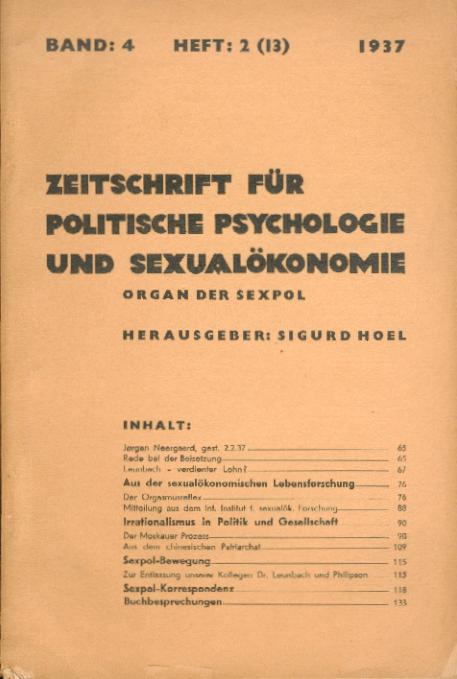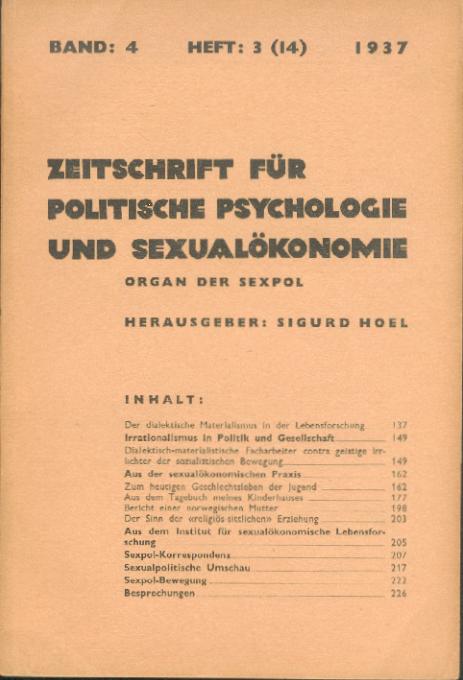Die »Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie« (ZPPS) wurde 1934 von dem (Ex-)Psychoanalytiker Wilhelm Reich im skandinavischen Exil (København) gegründet. Sie erschien als Vierteljahresschrift in insgesamt 15 Ausgaben (davon 3 Doppelhefte) mit insgesamt ca. 1000 Druckseiten. Die letzte Ausgabe erschien Anfang 1938. Für die Hefte 1-12 firmierte Reich selbst (unter seinem Pseudonym Ernst Parell) als Herausgeber, für die Hefte 13-15 der norwegische Schriftsteller Sigurd Hoel.
Die ZPPS wurde, anders als viele deutsche Exilzeitschriften jener Zeit, nie nachgedruckt. Sie ist lt. Zeitschriften-Datenbank (ZDB) nur in drei deutschen Bibliotheken vollständig vorhanden. Sie war nie Gegenstand einer grösseren historischen Forschungsarbeit und wurde selbst von Anhängern Reichs relativ wenig beachtet. Dieses Desinteresse muss verwundern, war doch Wilhelm Reich seit seiner Wiederentdeckung Mitte der 1960er Jahre für ein bis zwei Jahrzehnte ein vielgelesener Autor.
Reichs postume Popularität war zwiespältig. Zunächst fasste man in der Studentenbewegung der später so genannten "68er" ein Interesse an dem kommunistisch-antifaschistischen Reich (»Die Massenpsychologie des Faschismus« in der Version von 1933) und verurteilte alles, was Reich nach 1933 publiziert hat, insbesondere seine "Orgonomie", als Produkte eines "Verrückten". Parallel dazu hat es eine breite vulgärhedonistische Strömung gegeben, die den Psychologen und Sexualwissenschaftler Reich (»Die Funktion des Orgasmus« in der Version von 1927) zwar völlig missverstand, ihn aber gleichwohl zu einem Bestsellerautor des "alternativen" Buchhandels machte. Auch die dann ab 1969 im "normalen" Buchhandel erscheinenden Bücher Reichs (alte Texte, die er stark revidiert hatte, und neue, in seiner "orgonomischen" Periode geschriebene) erzielten noch Auflagen von mehr als 100'000 Stück. Diese Kassenerfolge sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 1) Reich von der etablierten Fachwelt nie ernsthaft rezipiert wurde, und dass 2) Reich zu keinem Zeitpunkt wirklich der "Gott der Neuen Linken" gewesen ist, als den ihn konservative Gegner gern sozusagen an die Wand malten.
Reich war schon der "Alten Linken" der Zwischenkriegszeit suspekt gewesen. Er galt bei Parteifunktionären als unsicherer Kantonist oder gar Schädling und wurde 1929 aus der SPÖ und 1933 aus der KPD ausgeschlossen. Und später in den USA waren es, neben ehemaligen Psychoanalytiker-Kollegen, vor allem "fellow travellers", Sympathisanten der stalinistischen Sowjetunion, die gegen ihn intrigierten. Die nicht parteigebundene intellektuelle Linke - auch wenn sie psychologischen Aspekten Gewicht beimass - hielt zu Reichs Anschauungen Distanz. Als Reich 1934 auf geheime Weisung Freuds aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung "entfernt" wurde, waren er und seine Schüler, die "Sexpol"-Gruppe, weitgehend isoliert. Trotzdem gelang es ihnen, unter den schwierigen Bedingungen des Exils eine anspruchsvolle Zeitschrift, die ZPPS, über immerhin fast fünf Jahre am Leben zu halten.
Die Neue Linke von "68", die Reich eher ungewollt wiederentdeckt hatte, liess sich nie kritisch auf die Erforschung der undurchsichtigen Vorgänge ein, die so merkwürdig reibungs- und diskussionslos die dauerhafte Abstempelung des einst aussergewöhnlich erfolgreichen Psychoanalytikers Reich (»Charakteranalyse«) zur Unperson der Psychoanalyse bewirkt hatten. Diese Linke war, sofern sie psychoanalytisch inspiriert war, eine freudianische, keine reichianische. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Mitscherlich - diese wahren "Götter der neuen Linken" schwiegen, wie schon in den 1930er Jahren, vielsagend zu Reich und seiner kuriosen Popularität in der Studentenbewegung. Und ihre Adepten, etwa Helmut Dahmer oder Reimut Reiche, verstanden dieses Schweigen ohne Nachfrage genau so, wie es gemeint war: Reich ist nicht ernst zu nehmen, ist ohne viel Aufhebens als quantité négligeable zu behandeln. Man beschwieg ihn, und nur gelegentlich etikettierte man ihn als naiven "wahren Sozialisten", als "Normativisten", natürlich als "Kleinbürger" - und, vor allem, als "verrückt gewordenen Orgonforscher". Das genügte.
Wer sich irgendwie als "Linksfreudianer" verstand, berief sich auf andere Autoren, distanzierte sich von Reich. Als Adorno von den im linksfreudianischen Sinn "heroischen Zeiten" der Psychoanalyse sprach, fiel natürlich nicht - wie auch sonst nirgendwo in seinen Werken, Briefen und Notizen - der Name Reich, nein, er zitierte Sándor Ferenczi. Dieser langjährige Freud-Intimus und mehr noch der "diplomatische" Otto Fenichel waren -- obwohl sie nur einige zaghaft-aufmüpfige Worte gegen Freuds Kulturkonservatismus gewagt hatten -- als psychoanalytische Ahnherren der Neuen Linken geschätzt. Die Ächtung Reichs, die schon unter Freud so erstaunlich reibungslos gelang, wurde von den "kritischen" Jungen stillschweigend fortgesetzt. Sie äusserte sich z.B. darin, dass Helmut Dahmer, als er 1972 (unter dem Pseudonym Christian Rot) die gesellschaftspolitischen Aufsätze Fenichels herausgab, den in dieser Hinsicht relevantesten wegliess und verschwieg, wahrscheinlich, weil er in Reichs ZPPS (Band 1, Heft 1; S. 43-62; s.u.) erschienen war.
Dieser neuere Linksfreudianismus blieb aller virtuosen Theorieakrobatik seiner Vertreter zum Trotz steril - was aufgrund seiner fundamentalen internen Widersprüchlichkeit nicht verwundert. Nachdem diese ideologische Richtung jahrelang kaum noch öffentlich in Erscheinung getreten war, veröffentlichte Russell Jacoby ein Buch über "Otto Fenichel and the Political Freudians" (1983, dt. 1985), in dem er den gesellschaftlichen Konformismus der nachfreud'schen Psychoanalyse attackierte. Jacoby meinte offenbar, mit einer simplen Fehletikettierung bewirken zu können, dass Otto Fenichel und ein halbes Dutzend passiver Leser seiner Rundbriefe, die allenfalls Kulissenpolitik in psychoanalytischen Cliquen betrieben, im Nachhinein zu politischen Freudianern werden, also zu Ausnahme-Psychoanalytikern, die heroisch auf verlorenem Posten standhielten, um dem allgemeinen Trend der Reduktion der Psychoanalyse auf eine blosse Therapieschule zu trotzen. Die Hauptquelle Jacobys waren einige der sog. Rundbriefe, die Fenichel 1934-1945 mit der Auflage strengster Geheimhaltung an sechs bis zehn "marxistische" Kollegen geschickt hatte. Reichs ZPPS indes, in der über fünf politisch ausserordentlich ereignisreiche Jahre hinweg "politische Psychologie" öffentlich auftrat, ignorierte auch Jacoby weitgehend.
Jacobys Arbeit hat - durch den Hinweis auf die Fenichel-Rundbriefe und durch Auszüge aus ihnen - dem seit Jahren kaum noch vernehmbaren Linksfreudianismus neue Impulse gegeben. Diese haben, mit einiger Verzögerung, zu zwei interessanten Veröffentlichungen geführt. Die erste ist ein Buch (»Der 'Fall' Wilhelm Reich«, hg. v. Karl Fallend und Bernd Nitzschke. Frankfurt/M: Suhrkamp 1997), das zwar auch aus jenen neuen Quellen schöpft, aber wesentlich ein Spät- und Nebenprodukt der turbulenten Diskussion um die Politik der organisierten Psychoanalyse gegenüber NS-Deutschland ist, die nach dem Tod Alexander Mitscherlichs 1982 unter deutschen Psychoanalytikern losbrach. Reich wird von Fallend und Nitzschke als Opfer der leisetreterischen Politik Freuds und der offiziellen Psychoanalyse sozusagen rehabilitiert -- wobei aber der viel wichtigere grundsätzliche Konflikt zwischen Freud und Reich, bei dem es radikal um die aufklärerische Potenz der Psychoanalyse ging, einmal mehr zugedeckt wird. Die andere Veröffentlichung ist, auf über zweitausend Seiten plus einer CD-ROM, die Edition der Rundbriefe (»Otto Fenichel - 119 Rundbriefe«, hg. v. Johannes Reichmayr und Elke Mühlleitner. Frankfurt/M: Stroemfeld 1998).
Diese beiden Publikationen sind hier - im Kontext des LSR-Projekts - insofern von Bedeutung, als sie historisches Quellenmaterial zur Rekonstruktion des Konflikts zwischen Freud und Reich teils bündeln (in einigen der Aufsätze zum "Fall" Reich), teils erstmals öffentlich verfügbar machen (einige der Rundbriefe). In diesem Zusammenhang sollte auch die Reich'sche »Zeitschrift für Politische Psychologie und Sexualökonomie« der Vergessenheit entzogen werden. Da mit einem Nachdruck in nächster Zeit aber kaum zu rechnen ist, soll auf diesen Netzseiten zunächst ein Überblick über die Inhalte der einzelnen Hefte gegeben werden. Nach und nach werden ausgewählte Texte folgen.
Bernd A. Laska / 10.02.01
|